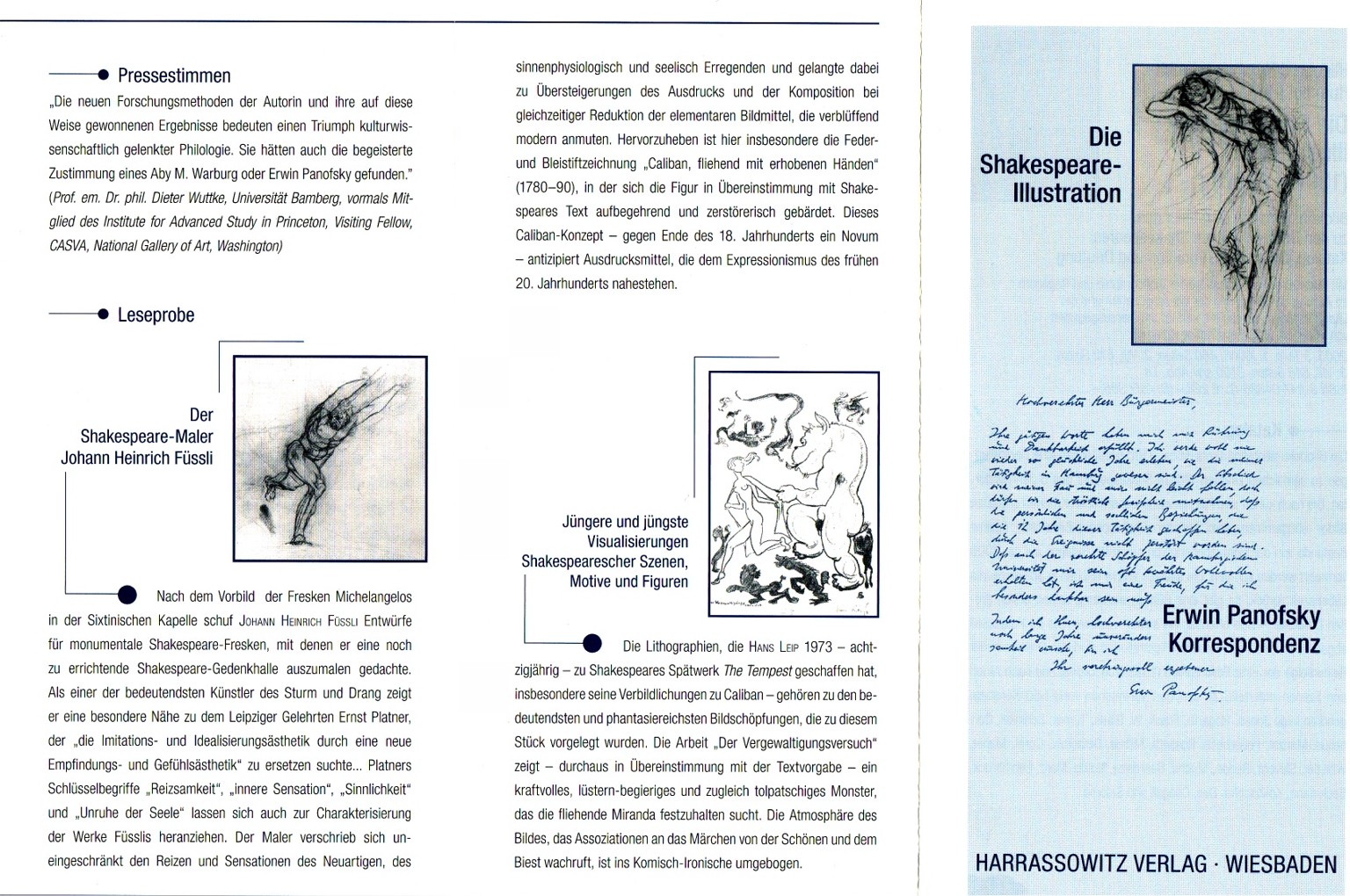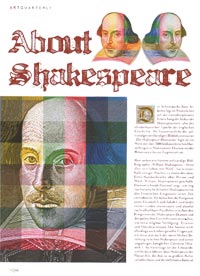Die Shakespeare-Illustration (1594-2000).
Bildkünstlerische Darstellungen zu den Dramen William Shakespeares: Katalog, Geschichte, Funktion und Deutung. 3 Teile
a. Inhaltsverzeichnis der Teile 1 bis
3
Teil 1

Vorwort der DFG-Projektleiter
Vorwort des Vorsitzenden der Kommission für Englische
Philologie
der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur
Notate der Herausgeberin
Danksagung
Geschichte, Funktion und Deutung bildkünstlerischer
Werke zu den Dramen William Shakespeares Dramen
Beispiele der Text-Bild-Relation im kultur-
und stilgeschichtlichen Kontext
Die Shakespeare-Illustration in Renaissance und Barock
Die Verbildlichungen Shakespearescher Dramen und ihre
Beziehung zur Historienmalerei des 17. Jahrhunderts
Die erste illustrierte Shakespeare-Ausgabe: Nicholas
Rowe (1709)
William Hogarth und Shakespeare: Historienmalerei, theatralische
Komposition und politischer Kommentar
Der Shakespeare-Illustrator Francis Hayman: Ansätze
zu psychologisierender Darstellung
Gavin Hamilton als Shakespeare-Maler
Alexander und John Runciman: Die vorromantische Shakespeare-Malerei
in Schottland
Boydells Shakespeare Gallery: Anspruch und Wirklichkeit
Der Shakespeare-Maler Johann Heinrich Füssli
Die Shakespeare-Darstellungen William Blakes: Archaischer
Urzustand und transzendentale Vision
William Turner: Reduktion und Neubestimmung des historisch-literarischen
Bildthemas
Die Shakespeare-Illustration im deutschsprachigen Raum
Daniel Chodowieckis ‘Hamlet’-Darstellungen
als Fixierung eines theatralischen Zeichensystems
Szenenprotokoll und Rollenreportage: Die Zeichnungen
der Gebrüder Henschel zu ‘King Lear’
Der Übergang zum bürgerlichen Illustrationsstil
des 19. Jahrhunderts: Johann Heinrich Ramberg
Die deutsch-römischen Maler und ihre Bedeutung für
die Shakespeare-Malerei des 19. Jahrhunderts
Shakespeares Dramen im Spiegel der deutschen Historienmalerei
des 19. Jahrhunderts
Die Shakespeare-Illustration in Frankreich: Eugène
Delacroix und Théodore Chasseriau
Englische Shakespeare-Malerei des 19. Jahrhunderts
Die Shakespeare-Verbildlichungen der Präraffaeliten
Zur impressionistischen Shakespeare-Darstellung in Frankreich
Shakespeare-Illustrationen im anglo-amerikanischen Impressionismus und
Neoimpressionismus
Impressionistische Visualisierungen der Werke Shakespeares
in Deutschland
Shakespeares Dramen im Spiegel von Symbolismus und Jugendstil
Shakespeare in der Bildkunst des 20. Jahrhunderts: Die
Wende zur Abstraktion
Shakespeare-Illustrationen des Expressionismus, des Kubismus
und des Vortizismus
Shakespeare als Anreger surrealistischer Bilder
Shakespeare-Darstellungen in der Geometrischen Abstraktion,
in der Konkreten Kunst, im Abstrakten
Expressionismus, im Informel und in der Lyrischen Abstraktion
Die Shakespeare-Illustration im Spiegel von Pop Art,
Comics und Cartoons
Die Shakespeare-Malerei der Jungen Wilden
Shakespeare in der Bildkunst der DDR
Jüngere und jüngste Visualisierungen Shakespearescher
Szenen, Motive und Figuren
Zusammenfassung
Anmerkungen
Abbildungsnachweis
Künstlerlexikon
Klassifizierte Bibliographie
Quellen
Bibliographien
Referenzwerke
Allgemeine Darstellungen
Künstler
Theater
Buchillustrationen
Spezialliteratur
Text-Bild-Beziehungen
Didaktik
Theorien
Technik
Varia
Abkürzungsverzeichnisse
Abgekürzt zitierte Literatur
Shakespeare-Dramen
Hinweise
Register der Teile 1, 2 und 3
Verzeichnis der Künstler
Verzeichnis der Stecher
Verzeichnis der Schauspieler
Verzeichnis der Figuren Shakespeares
Teil 2: Katalog

Abbildungen 0001-1493
Der Sturm (0001-0154)
Zwei Herren aus Verona (0155-0191)
Die lustigen Weiber von Windsors (0192-0311)
Maß für Maß (0312-0368)
Komödie der Irrungen (0369-0397)
Viel Lärm um nichts (0398-0446)
Verlorne Liebesmüh (0447-0472)
Ein Sommernachtstraum (0473-0775)
Der Kaufmann von Venedig (0776-0863)
Wie es euch gefällt (0864-0959)
Der Widerspenstigen Zähmung (0960-1026)
Ende gut alles gut (1027-1061)
Was ihr wollt (1062-1145)
Das Wintermärchen (1146-1222)
König Johann (1223-1264)
Richard II. (1265-1304)
Heinrich IV., Teil 1 (1305-1381)
Heinrich IV., Teil 2 (1382-1453)
Heinrich V. (1454-1493)
Bildlegenden mit Quellen- und Fundortangaben (0001-1493)
Der Sturm (0001-0154)
Zwei Herren aus Verona (0155-0191)
Die lustigen Weiber von Windsors (0192-0311)
Maß für Maß (0312-0368)
Komödie der Irrungen (0369-0397)
Viel Lärm um nichts (0398-0446)
Verlorne Liebesmüh (0447-0472)
Ein Sommernachtstraum (0473-0775)
Der Kaufmann von Venedig (0776-0863)
Wie es euch gefällt (0864-0959)
Der Widerspenstigen Zähmung (0960-1026)
Ende gut alles gut (1027-1061)
Was ihr wollt (1062-1145)
Das Wintermärchen (1146-1222)
König Johann (1223-1264)
Richard II. (1265-1304)
Heinrich IV., Teil 1 (1305-1381)
Heinrich IV., Teil 2 (1382-1453)
Heinrich V. (1454-1493)
Teil 3: Katalog

Abbildungen 1494-3000
Heinrich VI., Teil 1 (1494-1526)
Heinrich VI., Teil 2 (1527-1558)
Heinrich VI., Teil 3 (1559-1591)
Richard III. (1592-1681)
Heinrich VIII. (1682-1733)
Troilus und Cressida (1734-1768)
Coriolan (1769-1806)
Titus Andronicus (1807-1829)
Rome und Julia (1830-1964)
Timon von Athen (1965-1994)
Julius Cäsar (1995-2051)
Macbeth (2052-2305)
Hamlet (2306-2551)
König Lear (2552-2738)
Othello (2739-2868)
Antonius und Cleopatra (2869-2901)
Cymbeline (2902-2945)
Pericles (2946-2965)
Varia (2966-3000)
Bildlegenden mit Quellen- und Fundortangaben (1494-3000)
Heinrich VI., Teil 1 (1494-1526)
Heinrich VI., Teil 2 (1527-1558)
Heinrich VI., Teil 3 (1559-1591)
Richard III. (1592-1681)
Heinrich VIII. (1682-1733)
Troilus und Cressida (1734-1768)
Coriolan (1769-1806)
Titus Andronicus (1807-1829)
Rome und Julia (1830-1964)
Timon von Athen (1965-1994)
Julius Cäsar (1995-2051)
Macbeth (2052-2305)
Hamlet (2306-2551)
König Lear (2552-2738)
Othello (2739-2868)
Antonius und Cleopatra (2869-2901)
Cymbeline (2902-2945)
Pericles (2946-2965)
Varia (2966-3000)
  
b. Notate der Herausgeberin

Ursprung, Art, Umfang und Ziele
Das ursprüngliche Ziel des DFG- und Mainzer Akademie-Projekts
"Die Shakespeare-Illustration" bestand darin, die Sammlung des
1946 von Horst Oppel gegründeten Shakespeare-Bildarchivs zu bearbeiten
und für den Druck vorzubereiten. Mit dieser Aufgabe wurde ich Ende
1982 von den DFG-Projektleitern Rudolf Böhm, Horst Drescher und Paul
Goetsch beauftragt. Bei meiner Sichtung der Bestände stellte sich
heraus, daß das vorhandene Bildmaterial veraltet war und praktisch
komplett ersetzt werden mußte und daß die Sammlung erhebliche
Lücken aufwies. Letzteres veranlaßte mich, Anfang 1983 gezielte
Anfragen an mehr als 360 Museen und Galerien in Westeuropa und Nordamerika
zu richten, und zwar in dem von der Projektleitung geographisch eingegrenzten
Bereich Westeuropa und Nordamerika. Dabei konnte ich bei rund 75 % der
kontaktierten Institutionen zusätzlich eine große Fülle
bildkünstlerischer Arbeiten zum dramatischen Werk Shakespeares aufspüren,
die zu sichten, zu identifizieren, zu beschaffen, zu katalogisieren und
zu bearbeiten waren. Eine vollständige Erfassung war aber schon aus
Zeit- und Kostengründen weder im westeuropäischen noch im nordamerikanischen
Bereich möglich. Dennoch hatte das Projekt aufgrund der Vielzahl
neuer Funde eine Größenordnung erhalten, die eine entsprechende
Erhöhung der Personal- und Sachkosten dringend erforderlich machte.
Auf Antrag stellte mir die Mainzer Akademie damals rasch finanzielle Mittel
zur Verfügung, die es mir ermöglichten, mit der Inspektion des
neuen Bildmaterials an den jeweiligen Fund- bzw. Aufbewahrungsorten in
der Bundesrepublik Deutschland, England und Schottland zu beginnen. Nach
gründlicher gutachterlicher Prüfung gab die Deutsche Forschungsgemeinschaft
1985 dem Antrag auf die gewünschte Erhöhung der Personal- und
Sachmittel statt. Es galt nun, auf der Basis des vorhandenen und neu zu
beschaffenden Bildmaterials eine repräsentative, alle Shakespeare-Dramen
umfassende, kunst- und literaturwissenschaftlichen Kriterien genügende
Bilddokumentation von den Anfängen bis zur Gegenwart zu erarbeiten
- mit einem Bild- und Katalogteil, einer klassifizierten Bibliographie,
einem Künstlerlexikon, mehreren Registern und einem Abriß zu
“Geschichte, Funktion und Deutung bildkünstlerischer Werke
zu Shakespeares Dramen”.
Zeitlicher Rahmen und Standorte
Das im oben geschilderten Umfang erweiterte Forschungsprojekt
habe ich ab Oktober 1982 in ständigem Kontakt mit der Projektleitung
und ab 1985 unter zeitweiliger Mitwirkung von graduierten wissenschaftlichen
Hilfskräften und zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern durchgeführt.
Dabei gab es mehrfach längere Unterbrechungen, weil immer wieder
Anschlußfinanzierungen für Sach- und Personalkosten abzuwarten
waren. Mein Arbeitsplatz, das Shakespeare-Bildarchiv, befand sich von
1982 bis 1988 an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, von
1990 bis 1994 und erneut von 1998 bis 2002 an der Mainzer Akademie der
Wissenschaften und der Literatur. Bis zur vorerst endgültigen Unterbringung
des Archivs in der Akademie, die 1996 erfolgte, waren fünf Umzüge
zu bewältigen. Die aus dem Projekt finanzierten Zeitabschnitte meiner
Tätigkeit betrugen insgesamt sieben Jahre. Auch außerhalb dieser
Zeiten habe ich - mit erheblichem eigenen Kostenaufwand - die Arbeiten
fortgeführt, d.h. große Teile der Bibliographie kompiliert,
im In- und Ausland weitere Bildbelege gesammelt, zusätzliches Bildmaterial
aus meinem Privatbesitz zur Verfügung gestellt, die Einträge
des Künstlerlexikons geschrieben, den Abriß zur “Geschichte,
Funktion und Deutung bildkünstlerischer Werke zu Shakespeares Dramen”
verfaßt, Abkürzungsverzeichnisse und Register angelegt, Museumskorrespondenz
abgewickelt, weitere Bildrechte eingeholt und schließlich in Eigeninitiative
- und ebenfalls auf eigene Kosten - das gesamte Bildmaterial einscannen
und in zwei Sätzen von je 50 CDs abspeichern lassen.
Erweiterung der Archivbestände und Identifizierung
der Neuzugänge
Während der Beschaffungs- und Komplettierungsphase
in den 80er Jahren hielt ich mich zu Forschungszwecken in zahlreichen
in- und ausländischen Museen und Galerien auf, um das häufig
ungeordnete und nicht identifizierte Material vor Ort in Augenschein nehmen
und prüfen zu können. Nach umfangreichen Bestellaktionen (auch
zahlreicher illustrierter Werkausgaben) konnten die Bestände des
Archivs schließlich von rund 1600 auf rund 7000 Illustrationen erweitert
werden. Es folgten Identifizierung, Zuordnung, Katalogisierung und Bearbeitung
der Neuzugänge sowie eine rege Korrespondenz über einschlägiges
Bildmaterial mit öffentlichen Museen und Galerien sowie privaten
Eigentümern. Bei der Beschaffung, Bearbeitung und Identifizierung
des Materials haben Marion Thiel und Dr. Erwin Koeppen mitgewirkt. Während
meiner Beurlaubung von Oktober 1985 bis April 1986 wurde ich von Dr. Koeppen
vertreten. Da eine Reihe von (zumeist älteren) illustrierten Shakespeare-Ausgaben
über die Fernleihe in Deutschland nicht zu beschaffen und die ausländischen
Fotokosten unerschwinglich waren, mußte ich mich damit begnügen,
diese Titel in der Sektion 'Quellen' bibliographisch zu erfassen. Bei
der Eingliederung der Neuzugänge und der Bestimmung von Akt, Szene
und Figuren traten nicht selten Schwierigkeiten auf - insbsondere bei
älteren Simultankonzeptionen, vorläufigen Ideenskizzen
oder nicht näher bezeichneten Entwürfen.
Umfang, Art und Anordnung des Bildmaterials
Das Kernstück der vorliegenden Publikation bilden
3000 zwischen 1594 und 2000 entstandene bildkünstlerische Darstellungen
zu siebenunddreißig Dramen William Shakespeares. Es handelt sich
um Photoreproduktionen von Öl-, Acryl- und Temperagemälden,
Aquarellen, Gouachen, Bleistift-, Kreide- und Umrißzeichnungen,
Holzschnitten, Kupfer-, Stahl-, Holz- und Punktierstichen, Mezzotintos,
Radierungen, Lithographien, Schattenrissen, Chemitypien, Daguerrotypien,
Collotypien, Heliogravüren, Linolschnitten, Siebdrucken, Serigraphien,
Farbdrucken und weiteren Arbeiten in anderen Techniken aus den Beständen
des Shakespeare-Bildarchivs.
Unter den rund 550 Künstlern, die die bildlichen
Werke geschaffen haben, befinden sich herausragende Vertreter (nahezu)
aller Stilrichtungen aus fünf Jahrhunderten: Henry Peacham, Inigo
Jones, Frans Hals, Francesco Zuccarelli, William Hogarth, Johann Heinrich
Füssli, John Flaxman, Gavin Hamilton, Sir Joshua Reynolds, Angelika
Kauffmann, Benjamin West, George Romney, James Barry, John Constable,
William Blake, William Turner, Daniel Chodowiecki, Johann Heinrich Ramberg,
Joseph Anton Koch, Franz Pforr, Carl Philipp Fohr, Peter von Cornelius,
Wilhelm von Kaulbach, Karl Theodor von Piloty, Karl Friedrich Schinkel,
Adolph von Menzel, Anselm Feuerbach, Victor Müller, Max Klinger,
Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais, Walter Deverell, Arthur
Hughes, Joseph Noel Paton, Eugène Delacroix, Théodore Chassériau,
Camille Corot, Edouard Manet, James McNeill Whistler, Lovis Corinth, Max
Slevogt, Alfred Kubin, Odilon Redon, John Singer Sargent, Walter Crane,
Gordon Craig, Lucien Pissarro, Alfons Mucha, Aubrey Beardsley, Arthur
Rackham, Emil Nolde, Franz Marc, Wilhelm Lehmbruck, Oskar Schlemmer, Thomas
Theodor Heine, Olaf Gulbransson, Max Beckmann, Oskar Kokoschka, Max Ernst,
André Masson, Salvador Dalí, Man Ray, Stanley William Hayter,
Willi Baumeister, Marc Chagall, Ernst Wilhelm Nay, Larry Rivers, Ben Shahn,
Jim Dine, William Copley, Peter Blake, Josef Hegenbarth, Hans Leip, Walter
Stöhrer, Elvira Bach, Markus Lüpertz, K. H. Hödicke, Johannes
Grützke, Helmut Middendorf, Salomé, Wolfgang Utzt, Ronald
Paris, Eva Maria Viebeg, Gerhard Hofmann und Alfred Hrdlicka.
Die Präsentation des Bildmaterials war Gegenstand
intensiver Beratungen mit den Projektleitern. Die Entscheidung fiel zugunsten
einer Zuordnung der Bilder zum dramatischen Werk Shakespeares, und zwar
nach ‘Drama’, ‘Akt’ und ‘Szene’. Zusätzlich
wurden für jedes Stück die Rubriken ‘Figuren’, ‘Schauspieler’
und ‘Simultandarstellungen’ eingerichtet. Bei der Anordnung
innerhalb der Szene waren die Entstehungsdaten der Werke maßgeblich.
Auf Gruppierungen nach Motiven wurde verzichtet. Ließ sich das Jahr
der Entstehung nicht ermitteln und standen auch keine anderen ungefähren
Datierungskriterien zur Verfügung, wurde ein geschätztes Datum
zugrundegelegt (Geburtsjahr des Künstlers plus 20 Jahre). Werke,
die sich keinem bestimmten Shakespeare-Drama zuordnen ließen, wurden
abschließend unter ‘Varia’ chronologisch erfaßt.
Die Reihenfolge der Stücke richtet sich nach
der benutzten Alexander-Edition: William Shakespeare, The Complete Works.
Ed. Peter Alexander. London/Glasgow, 1951, 2. Aufl. 1978. Sieht geht damit
letztlich auf die First Folio Edition aus dem Jahre 1623 zurück,
in der allerdings der Text von Pericles ausgespart wurde.
Herausgeberschaft
Durch Beschluß der Projektleitung, dem eine Anfrage
der DFG zugrundelag, wurde mir 1989 die Herausgeberschaft der geplanten
Publikation übertragen.
[...]
Künstlerlexikon
Das Künstlerlexikon besteht aus rund 550 Kurzbiographien
zu allen Künstlern, die mit einem oder mehreren Werken in der Auswahlsammlung
0001 bis 3000 vertreten sind. Rund fünfzehn Prozent dieser Viten
sind in den Standard-Nachschlagewerken nicht verzeichnet. In einigen Fällen
war die Ermittlung biographischer Details nicht möglich. Die in “Geschichte,
Funktion und Deutung bildkünstlerischer Werke zu Shakespeares Dramen”
zusätzlich herangezogenen Künstler sind im Künstlerlexikon
nicht verzeichnet. Ihre Namen und Werke sind im ‘Verzeichnis der
Künstler’ erfaßt.
Die Strukturierung der Einträge des Lexikons erfolgte,
sofern bekannt, prinzipiell nach den Gesichtspunkten: (1) Ausbildung des
Künstlers, Lehrer, künstlerische Prägung, (2) Einflüsse
auf die künstlerische Entwicklung (Reisen, Kontakte, literarische
Vorlieben), (3) Hauptwerke, (4) Auszeichnungen, (5) Ausstellungsorte,
(6) stilistische Einordnung des künstlerischen Werks, (7) Wege des
Künstlers zur literarischen Illustration, (8) Beziehung des Künstlers
zum Theater, (9) Auseinandersetzung des Künstlers mit dem Werk Shakespeares.
Die Suche nach biographischen Informationen war häufig
dadurch erschwert, daß es zu vielen der älteren Shakespeare-Illustratoren
in den gängigen Nachschlagewerken und Speziallexika keine Einträge
gibt. In diesen Fällen waren Recherchen in zumeist englischen Quellen
des 18. und 19. Jahrhunderts erforderlich - in Künstler- und Werkregistern,
Katalogen, Verzeichnissen ausgestellter Bilder etc. Da mir die Universität
Mainz Anfang 1994 dankenswerterweise Mittel für eine weitere Forschungsreise
nach London zur Verfügung gestellt hatte, konnte ich in der British
Library und im Britischen Museum noch einmal erfolgreich recherchieren
und in rund achtzig Fällen fehlende biographische Angaben ergänzen.
Auch bei einer Reihe von Repräsentanten der jüngeren und jüngsten
Künstlergeneration, die in den Künstlerlexika der Gegenwart
noch nicht erfaßt sind, war die Beschaffung biographischer Daten
häufig nur unter erschwerten Bedingungen möglich.
Das Lexikon wurde in der Zeit von 1998 bis 1999 von der
wissenschaftlichen Mitarbeiterin Jutta Ziegler noch einmal durchgesehen.
Unter Zuhilfenahme von neueren und neuesten Nachschlagewerken überprüfte
Frau Ziegler alle Einträge auf ihre sachliche Richtigkeit. Da viele
Künstler zur Entstehungszeit des Lexikons noch lebten oder ihr Ableben
in den Nachschlagewerken noch nicht verzeichnet war, konnten zahlreiche
Todesjahre erst im Rahmen der erneuten Durchsicht in der Schlußphase
des Projekts recherchiert und eingefügt werden. Die Ermittlung gelang
in ca. 90 Fällen. Frau Ziegler vereinheitlichte Schreibweisen von
Namen und Werken, bereicherte das Lexikon mit Informationen über
Künstler, über die bisher nur wenig bekannt war, und verfaßte
die Kurzbiographien jener Künstler, deren Werke ich in den Jahren
1998, 1999 und 2000 noch in die Auswahlsammlung (0001-3000) einbringen
konnte: Karl Blechen, Gustave Courbet, Margreth Hirschmiller-Reinhard,
Max Klinger, André Masson, Ronald Paris und Karl Friedrich Schinkel.
Wie das Register der Künstler, das sich auf die
Gesamtmenge der Bilder der Auswahlsammlung und auf ihre Bildlegenden bezieht
und dem Leser bzw. Betrachter den direkten Zugriff auf alle Shakespeare-Illustrationen
eines Künstlers ermöglicht, bietet auch das Künstlerlexikon
dem Benutzer die Möglichkeit des raschen Informationszugriffs, der
ihm eine erste Übersicht über die (wesentlichen) Arbeiten eines
Künstlers zum Werk Shakespeares vermittelt. Es bietet darüber
hinaus - in knapper und kompakter Form - auch biographisches sowie kunst-
und kulturwisssenschaftliches Hintergrundwissen.
Geschichte, Funktion und Deutung der bildkünstlerischen Werke
zu Shakespeares Dramen
Der Abriß ‘Geschichte, Funktion und
Deutung der bildkünstlerischen Werke zu Shakespeares Dramen’
bietet dem Leser einen nach Epochen und/oder Stilrichtungen gegliederten
und mit Zwischenüberschriften versehenen Überblick über
die Geschichte der Shakespeare-Illustration und vermittelt anhand zahlreicher
Beispiele der Text-Bild-Relation wesentliche Tendenzen und Entwicklungen
der bildlichen Rezeption Shakespeares im kultur- und stilgeschichtlichen
Kontext. Er beginnt mit Werken aus der letzten Dekade des 16. Jahrhunderts
und endet mit Beispielen aus einer Bildserie zu Hamlet aus dem Jahre 2000.
Dieser historische Überblick beleuchtet die Rolle der Shakespeare-Illustration
in der europäischen Historienmalerei vom frühen 17. bis zum
späten 19. Jahrhundert, bekundet den Wandel der Text-Bild-Beziehungen,
der Figurenkonzeption und Aufführungspraxis und markiert - mit Werken
von Hogarth, Chodowiecki, Johann Heinrich Füssli, William Blake,
William Turner sowie Arbeiten der Präraffaeliten - Höhepunkte
der bildlichen Wirkungsgeschichte Shakespeares. Er demonstriert schließlich,
daß die Shakespeare-Illustratoren die ‘Kunstwende’ an
der Schwelle und zu Beginn des 20. Jahrhunderts mitvollzogen haben.
Der Text ist mit einem ausführlichen wissenschaftlichen
Anmerkungsapparat ausgestattet, enthält zahlreiche Referenzabbildungen
der Auswahlsammlung (0001-3000) und zusätzliches Bildmaterial, das
zum Vergleich herangezogen wurde.

|
c. Auszug aus “Geschichte, Funktion und Deutung”
Geschichte, Funktion und Deutung bildkünstlerischer Werke zu Shakespeares
Dramen
Beispiele der Text-Bild-Relation im kultur- und stilgeschichtlichen Kontext
Die Geschichte der Shakespeare-Illustration markiert einen signifikanten
Teilbereich der europäischen und anglo-amerikanischen Kulturgeschichte.
Wesentliche Tendenzen und Erscheinungsformen der Literatur-, Kunst- und
Theatergeschichte (aber auch der Geschichte der Lebensstile, der Mode
und des Geschmacks) spiegelnd, nimmt sie bereits in der frühen Schaffensphase
William Shakespeares (1564-1616) ihren Anfang, zu einer Zeit also, als
die großen Tragödien Hamlet, Othello, King Lear und Macbeth
noch nicht geschrieben waren, der Name des Autors jedoch schon ein Publikumsmagnet
des jungen elisabethanischen Theaters war.
Der hier vorzunehmende historische Überblick möchte die wesentlichen
Strömungen und Entwicklungen der vierhundertjährigen bildkünstlerischen
Rezeptions- und Wirkungsgeschichte der Dramen Shakespeares in der Bildkunst
anhand repräsentativer Beispiele registrieren und - interdisziplinär
- unter Berücksichtigung kunst- und theaterwissenschaftlicher, soziokultureller
und literarhistorischer Konzepte in ihren kulturgeschichtlichen Zusammenhängen
untersuchen.
Die Shakespeare-Illustration in Renaissance und Barock
Bei den ersten Bildzeugnissen zu den Dramen William Shakespeares,
die bereits während seiner Lebenszeit entstanden, handelt es sich
um eine Federzeichnung zu seiner vermutlich frühesten Tragödie
und um ein steinernes Monument zu einer seiner frühen Komödien.
Letzteres ist ein Oktogon mit Inschrift und Reliefs (Abb. 001), das sich
im Garten von New Place, Shakespeares Residenz in Stratford, befindet
und offensichtlich von ihm selbst (oder seiner Familie) in Auftrag gegeben
wurde. Als Entstehungszeit kommen die Jahre unmittelbar nach dem Erwerb
des Anwesens im Jahre 1597 in Frage, als der Dramatiker es seinen Vorstellungen
und Wünschen gemäß umgestalten ließ. Die Datierung
wird bestätigt durch ein paläographisches Fachgutachten. Die
heute stark verwitterte und unleserlich gewordene Inschrift befindet sich
auf der dem Garten zugewandten Seite des Oktogons. Die sieben übrigen
Seiten sind mit kunstvollen figürlichen Reliefs geschmückt,
die im Verlauf der Jahrhunderte ebenfalls stark gelitten haben.
Das Oktogon hat in der Shakespeare-Forschung, soweit bekannt, bisher keine
Beachtung gefunden. Seine Inschrift und Illustrationen wurden offenbar
nicht wahrgenommen oder für nicht erwähnenswert gehalten und
nicht identifiziert. Der Verfasserin gelang die Rekonstruktion des Textes.
Es handelt sich um eine Stelle aus Shakespeares As You Like It (II, 7)
über die sieben Lebensalter, zu der der Dichter durch die aus dem
Mittelalter überlieferte Vorstellung von den sieben Stadien der menschlichen
Existenz (Abb. 2) angeregt worden sein könnte:


|
DIE GANZE WELT
IST BÜHNE, UND ALLE
FRAU´N UND MÄNNER
BLOßE SPIELER.
SIE TRETEN AUF
UND GEHEN WIEDER AB,
SEIN LEBEN LANG
SPIELT EINER MANCHE ROLLEN
DURCH SIEBEN AKTE HIN. |
[Übersetzung: August Wilhelm Schlegel]
Diese Worte des Shakespeareschen Philosophen und Melancholikers
Jaques haben die Künstler späterer Jahrhunderte immer wieder
zu bildlicher Darstellung inspiriert (vgl. Bd. 2, Abb. 892 ff.). Das Oktogon
belegt, daß auch Shakespeare selber und/oder seine Familie diese
Textstelle besonders geschätzt und ihre Visualisierung veranlaßt
haben. Die Wahl des Stückes könnte auch damit zusammenhängen,
daß die großen Meisterwerke (Hamlet, Othello, King Lear und
Macbeth) noch nicht geschrieben waren - sie alle entstanden erst nach
der Essex-Rebellion (1601) und Shakespeares Wende zum Tragischen - und
der Dramatiker As You Like It anscheinend gut ein Jahr nach dem Erwerb
und Umbau von New Place überarbeitete und abschloß, aber nicht
veröffentlichte. Der Druck des Textes mit seinen zahlreichen kritischen
Zeitbezügen hätte den Autor mit Sicherheit gefährdet. So
nimmt es nicht wunder, daß diese Komödie - wie rund die Hälfte
aller Shakespeareschen Stücke - erst im Jahre 1623 erschien, also
sieben Jahre nach dem Tod des Dichters, und zwar in der von seinen Freunden
und Kollegen John Heminge und Henry Condell besorgten First Folio Edition.
Das Oktogon verdeutlicht Shakespeares Vorliebe für die bildenden
Künste, die uns aus seinem Werk bekannt ist. In The Winter’s
Tale (V, 2) nennt der Dramatiker den Raffael-Schüler Guilio Romano
(ca.1499-1546) beim Namen. Es ist zu vermuten, daß er die Arbeiten
dieses Künstlers, den er als ”rare Italian master” rühmt,
in Italien kennengelernt hat.
Die von einem unbekannten Künstler auf sieben Tafeln des Oktogons
geschaffenen Reliefs sind exakte Verbildlichungen des Shakespeareschen
Textes (vgl. As You Like It, II, 7, 139-143). Sie führen vor Augen,
daß der Dichter - in Übereinstimmung mit der auf Simonides
und Horaz zurückgehenden und in der Renaissance wiederbelebten Ut
pictura poesis-Konzeption - von der Gleichrangigkeit von Text und Bild
ausging. Die ausgewählten Beispiele zeigen das sechste und das siebte
Lebensalter (Abb. 003 und Abb. 004).
In Verbindung mit der lateinischen und der englischen Inschrift auf der
schwarzen Marmortafel unterhalb der Grabbüste Shakespeares in der
Dreifaltigkeitskirche in Stratford, die Größe und Genialität
des Dichters hervorheben und ihn mit Nestor, Sokrates und Vergil auf eine
Stufe stellen, ist das Monument im Garten von New Place nun als das wohl
wichtigste zeitgenössische Bild- und Textzeugnis für die Autorschaft
des Stratforder Bürgersohns an den weltberühmten Dramen anzusehen.
Das Oktogon diente offensichtlich als Postament für eine Plastik
oder einen anderen dekorativen Gegenstand. Die Erörterung der verschiedenen
Möglichkeiten mit einem Experten führte unter Berücksichtigung
gegebener Tatsachen zu der Annahme, daß es sich um eine Sonnenuhr
(Blocksonnenuhr) gehandelt hat, wie sie für die Zeit um 1600 belegt
ist.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fand man unter den Manuskripten der Bibliothek
des Marquess of Bath in Longleat House bei Warminster in der Grafschaft
Wiltshire eine Federskizze, die als Illustration zu Shakespeares früher
und publikumswirksamer Rachetragödie Titus Andronicus (Abb. 1807)
identifiziert wurde. Die 1907 katalogisierte Zeichnung stammt - wie auf
dem Blatt von späterer Hand vermerkt - von dem jungen, in London
aufgewachsenen Cambridge-Absolventen Henry Peacham. Sie trägt ein
Datum, das als 1594 oder 1595 zu deuten ist. Ein Eintrag im Diarium des
Theatermanagers Philip Henslowe belegt, daß Titus Andronicus (vermutlich
erstmals) am 24. Januar 1594 auf der Bühne gespielt wurde. Nur rund
14 Tage später, am 6. Februar 1594, ließ der Londoner Drucker
John Danter die erste Quartausgabe des Stückes unter dem Titel ”a
Noble Roman Historye of Tytus Andronicus” in das Londoner Drucker-
und Buchhändlerverzeichnis (Stationers’ Register) eintragen
- zusammen mit einer Ballade zum selben Thema. Angesichts der Tatsache,
daß die Londoner Theatertruppen ‘ältere’ Dramen
zu meiden pflegten, weil die Theaterbesucher neue Stücke zu sehen
wünschten, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, daß die
Zeichnung erst im Jahre 1595 entstand, für das zudem keine Aufführung
nachgewiesen ist. Wahrscheinlicher ist, daß sie 1594 geschaffen
wurde, als Shakespeares Sensationsstück für Furore sorgte und
Besucher in großer Zahl anlockte - vermutlich auch den jungen Henry
Peacham. Daher wird hier das Jahr der ersten Aufführung als Entstehungsjahr
zugrunde gelegt.
Nach derzeitigem Stand ist Peachams Arbeit die älteste Shakespeare-Illustration.
Ihre Bildunterschrift lautet: ”Enter Tamora pleadinge for her sonnes
going to execution”. Dargestellt ist das Tableau der Eingangsszene
des Stückes: der siegreiche römische Feldherr Titus Andronicus
mit Gefolge auf der linken und die gefangene Gotenkönigin Tamora
mit ihren Söhnen sowie dem Mohren Aaron auf der rechten Seite.
Während Peachams Illustration anfangs nur wenig Aufmerksamkeit fand,
ist sie ab den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts verstärkt Gegenstand
literaturhistorischer Untersuchungen gewesen. Die Frage, ob das früheste
(bekannte) bildkünstlerische Werk zu einem Shakespeare-Drama eine
Bühnenzeichnung ist, d. h. während (und/oder unmittelbar nach)
einer Aufführung des Stückes entstand, wurde bisher nicht oder
nicht überzeugend beantwortet. Nach eingehenden Untersuchungen des
soziokulturellen Hintergrunds der Shakespearezeit, der divergierenden
Text-Bild-Relation und schließlich unter Heranziehung theatersemiotischer
Kriterien (einschließlich des theatralischen Zeichencodes des Barockzeitalters)
gelangte ich zu dem Schluß, daß tatsächlich eine Londoner
Theaterszene wiedergegeben wurde und die dargestellten Personen elisabethanische
Schauspieler sind.
Ein entscheidendes Indiz dafür, daß hier auf der Bühne
agierende Schauspieler festgehalten wurden, ist der bei Tamora deutlich
erkennbare Adamsapfel. Damit wird der bekannte Sachverhalt, daß
die weiblichen Rollen von männlichen Darstellern gespielt wurden,
bestätigt. Meine auf Bildvergleichen mit zeitgenössischen Burbage-Porträts
gründende These, bei dem Darsteller der Tamora müsse es sich
um Richard Burbage handeln, wurde durch das kriminaltechnische Bildgutachten
des von mir 1995 konsultierten Sachverständigen beim Bundeskriminalamt
bestätigt. Dieses Ergebnis sowie die Tatsache, daß Burbage
und Shakespeare im Jahre 1594 an die Spitze der neu formierten Theatertruppe
The Chamberlain’s Men traten, die führenden Rollen spielten
und Weihnachten dieses Jahres - zusammen mit dem Komiker William Kempe
- vor der Königin auftraten, legen die Annahme nahe, daß die
Titelrolle von Shakespeare selber gespielt und er in Peachams Zeichnung
als siegreicher Feldherr Titus Andronicus figuriert.
d . Rezensionen und Stellungnahmen
Michael Patterson, book review of Die Shakespeare-Illustration 1594-2000 [The Shakespeare Illustration]. Ed. By Hildegard Hammerschmidt-Hummel. Wiesbaden: Harrassowitz, 2003. 3 vols., pp. 1257 + illus., Theatre Research International 33 (2008), pp. 327-328 http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=2188440 - doi:10.1017/S0307883308004094
In 1946 the prominent German theatre scholar Horst Oppel began collecting images of Shakespeare’s characters and plays, eventually amassing a massive archive, which he intended to publish in ten volumes. His death in 1979 meant that the project had to be abandoned. Now, fortunately, under the auspices of the Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, the distinguished Shakespearian scholar Hildegard Hammerschmidt-Hummel has realised a modified form of Oppel’s project in this impressive three volume work.
Three thousand illustrations are reproduced here, from Henry Peacham’s crude sketch of Titus Andronicus in 1594 to abstract paintings of the late twentieth century. The first volume relates artistic responses to Shakespeare to the artistic style of the period (in the way that Stuart Sillars does so successfully for the eighteenth and early nineteenth centuries in his Painting Shakespeare, CUP, 2006.) We are led through the heroic and historical images of artists like Hogarth and Romney, the striking interpretations of Fuseli and Blake, Turner’s monumental visions, the flowing draperies and dramatic postures of the nineteenth century, the saccharine versions of the pre-Raphaelites, the fleeting images of artists like Slevogt, up to more recent surrealist and abstract interpretations. Volumes two and three contain reproductions ordered conveniently according to the play.
All this is supported by an extensive bibliography, details of the sources of all the illustrations, and a useful lexicon of their artists.
...
Yet again German scholarship has made a hugely significant contribution to Shakespeare. It would be an even greater contribution if these remarkable volumes could be translated into English.
***
„About Shakespeare“, Art Quarterly (August 2007), S. 66-67.
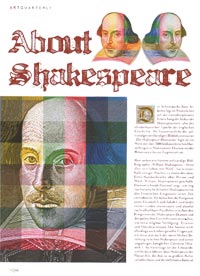 
***
Auszug aus der Rezension von Dr. Klaus Schreiber, Herausgeber des Digitalen Rezensionsorgans für Bibliothek und Wissenschaft (vormals Informationsmittel für Bibliotheken - IFB), 12/2004:
Der Ursprung dieses Werkes geht auf den bekannten deutschen Anglisten und Shakespeare-Forscher Horst Oppel zurück, der 1946 ein Shakespeare-Bildarchiv gründete, das er nach seiner Emeritierung 1978 zu bearbeiten und herauszugeben beabsichtigte, wozu es - bedingt durch schwere Krankheit und baldigen Tod (1982) - nicht mehr kam. Seinen zahlreichen Schülern ist es jedoch zu danken, daß das Projekt nicht aufgegeben wurde, sondern mit Hife langjähriger Förderung durch die DFG und durch das Engagement der Mainzer Akademie der Wissenschaften, an der das Archiv seit 1996 untergebracht ist, mit dieser eindrucksvollen Publikation abgeschlossen werden kann, die - trotz der Zuarbeit zahlreicher Personen - das Werk der in Mainz lehrenden Anglistin und Shakespeare-Spezialistin (wie ihr Lehrer Oppel) Hildegard Hammerschmidt-Hummel ist. Ihr gelang es, die Sammlung Oppels von rund 1600 auf rund 7000 Illustrationen zu erweitern, und aus dieser großen Masse legt sie jetzt eine repräsentative Auswahl von “3000 zwischen 1594 und 2000 entstandene(n) bildkünstlerische(n) Darstellungen zu siebenunddreißig Dramen William Shakespeares” (S. XVIII) vor, die in allen denkbaren künstlerischen Illustrationstechniken von rund 550 Künstlern geschaffen wurden. Vermutlich gehören die Werke Shakespeares zu den - nach der Bibel - am häufigsten illustrierten literarischen Werken der Weltliteratur zusammen mit Dante, und wohl noch vor Cervantes und Goethe.
***
Auszug aus der Besprechung von Bernhard Geil, Journal für Kunstgeschichte, 8. Jahrgang 2004, Heft 3 (www.uni-landau.de/journal), S. 198-203:
Die hier anzuzeigende dreibändige Publikation beschäftigt sich mit der Rezeption sämtlicher siebenunddreißig Shakespeare-Dramen in der bildenden Kunst von den Anfängen (Ende des 16. Jahrhunderts) bis hin zu jüngsten künstlerischen Auseinandersetzungen (2000). War die wissenschaftliche Aufarbeitung von bildlichen Gestaltungen zum Werk William Shakespeares in Einzeluntersuchungen immer wieder unternommen worden, so hatte eine umfassende und benutzerfreundliche Darstellung in Form einer Bilddokumentation bisher ausgestanden. Erarbeitet wurde das Werk, das aus einem langjährigen Forschungsprojekt der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur hervorgegangen ist, von der Anglistin und ausgewiesenen Shakespeare-Kennerin Hildegard Hammerschmidt-Hummel, die also nicht nur als Herausgeberin fungiert, wie man aufgrund des Titels meinen könnte. Sein Kernstück bildet eine Auswahlsammlung von 3000 Darstellungen. Sie stammen aus dem von der Forscherin im Zuge ihrer Arbeit erheblich erweiterten und nun rund 7000 Bildwerke umfassenden Shakespeare-Bildarchiv der Akademie der Wissenschaften, das damit weltweit einzigartig ist.
Der erste Band (Teil 1) enthält einen geschichtlichen Überblick über die Shakespeare-Illustration, ein informatives Künstlerlexikon mit Kurzbiographien zu allen im Bild- und Katalogteil vertretenen Künstlern (weit über 500) sowie eine umfassende, vorzüglich klassifizierte Bibliographie. Hinzu kommen vier sehr hilfreiche Spezialregister (zu Künstlern, Stechern, Schauspielern und Shakespeare-Figuren), die den Materialreichtum aller drei Teile bequem erschließen. Den überaus schlüssig gegliederten Bild- und Katalogteil umfassen die beiden anderen Bände. Die Präsentation der Darstellungen erfolgt dort gegliedert nach Drama, Akt und Szene, wodurch es zu aufschlußreichen Gegenüberstellungen unterschiedlicher künstlerischer Auffassungen kommt. Im Anschluß an jedes der so dokumentierten Werke folgen noch die weiteren Rubriken ‘Figuren’, ‘Schauspieler’ (es handelt sich um Schauspieler-Rollenporträts) und ‘Simultandarstellungen’. Zusammen mit der Rubrik ‘Varia’, die den Katalog abschließt und freie Gestaltungen erfaßt, die nicht eindeutig bestimmten Stücken zugewiesen werden können, erweitern sie die Einzeldokumentationen. Sie führen so die ganze Breite der künstlerischen Auseinandersetzung mit Shakespeares Werk durch die Jahrhunderte vor Augen.
...
Hildegard Hammerschmidt-Hummel beleuchtet in ihrem kenntnisreichen, sehr übersichtlich gegliederten Abriß [in Teil I] (S. 1-201), der mit einem vorzüglichen wissenschaftlichen Apparat ausgestattet ist, wesentliche Entwicklungen der bildkünstlerischen Rezeption Shakespeares. Als früheste Illustration dürfte eine Federzeichnung von Henry Peacham aus dem Jahr 1594 oder 1595 gelten, die ein Bühnengeschehen zu ‘Titus Andronicus’ zeigt. Darauf ist vermutlich einer der ersten großen Shakespeare-Darsteller, Richard Burbage, dargestellt (eine Annahme, die die Verfasserin sogar auf ein kriminaltechnisches Bildgutachten des BKA stützt) und offenbar Shakespeare selbst in der Titelrolle; dieser trat 1594 mit Burbage im Rahmen einer berühmten Schauspieltruppe [The Chamberlain’s Men] gemeinsam auf, weshalb die Vermutung durchaus ansprechend ist.
...
Die Publikation stellt eine wichtige, im ganzen als vorbildlich zu bezeichnende Dokumentation dar und wird sich zweifellos als Standardwerk bewähren.
***
Book review by the German Anglicist and Shakespeare
scholar Professor emeritus Dr Kurt Otten, University of Heidelberg / Visiting
Fellow, Clare Hall, Cambridge University, Symbolism. A New International
Annual of Critical Aesthetics VII (New York: AMS, Spring 2005) -
Excerpt:
(On Die Shakespeare-Illustration (1594-2000).
Bildkünstlerische Darstellungen zu den Dramen William Shakespeares:
Katalog, Geschichte, Funktion und Deutung. Mit Künstlerlexikon, klassifizierter
Bibliographie und Registern. Im Auftrag der Akademie der Wissenschaften
und der Literatur, Mainz, kompiliert, verfasst und herausgegeben von Hildegard
Hammerschmidt-Hummel. 3 Teile. Mit 3100 Schwarzweissabbildungen / Shakespearian
Illustrations (1594-2000). Pictorial representations to the plays of William
Shakespeare: Catalogue, history, function and interpretation. With a dictionary
of artists, a classified bibliography and indexes. Compiled, authored
and edited by Hildegard Hammerschmidt-Hummel. 3 vols. 3100 illustrations
in black and white (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2003)
Horst Oppel, to whose memory this work is dedicated,
was Professor of English at the Universities of Mainz and Marburg and
a member of the Academy of Arts and Sciences at Mainz. He began the collection
of Shakespeare illustrations with the idea that works of visual art inspired
by the key scenes and fundamental concepts in Shakespeare should be studied
on a comparative basis. In his view, the interplay between Shakespeare
and works of art from different countries and epochs is a decisive element
in the continuous and complex history of the European tradition.
...
Horst Oppel and some of his students published essays
and dissertations that defined and delineated this area of study. Oppel
retired from the university in 1978 but continued research in connection
with the Academy in Mainz. ... After his death [in 1982], the continuation
of the research project was entrusted to a joint committee of advisers
consisting of former students of Oppel in collaboration with the German
National Research Fund. This committee finally selected Dr. phil. habil.
Hildegard Hammerschmidt–Hummel as Oppel’s successor as director
of the Archive. She was one of Oppel’s best students and had already
assisted him with the Archive at Marburg and at Mainz. She was officially
appointed as director of the Archive in 1982. From 1979 to 1982 she served
as German Consul for Cultural Affairs at the German Consulate General
in Toronto (Canada).
The first part (vol. 1) of her book contains the Prefaces
of the Board of Directors, i.e. Rudolf Böhm, Horst W. Drescher and
Paul Goetsch and of the Chairman of the Commission of the Academy, Werner
Habicht, and provides us with a general outline of its scholarly aims
and methods and sketches the role of the author and editor in the development
of the project. In this general outline Hildegard Hammerschmidt-Hummel
also discusses the limits of such an undertaking and the difficulties
and delays which inevitably occur in comprehensive projects of this nature.
The first part was specially designed to produce a selection of the 3000
illustrations and a classified and annotated catalogue, as well as an
introduction describing the most important cultural patterns in Shakespeare’s
changing influence on the visual arts within Western Europe (Great Britain,
Germany, France and others) and the USA. Also included are an artists’
dictionary, a classified bibliography with about 5200 entries, several
lists of abbreviations and 4 indexes. At present, the general catalogue
of the archive lists 7000 illustrations of which 3000 by 550 different
artists have been selected for inclusion in parts 2 (vol. 2) and 3 (vol.
3). The relationship between the text and the classified catalogue is
indicated by a short caption which also gives the sources.
The first part presents the selected illustrations followed
by brief comments on Shakespeare’s text and its intended message
and a commentary defining the illustrations within their historical contexts.
Particular attention is paid to the immense influence of Shakespeare’s
stage productions and to their reception by their audiences. The most
memorable actors and directors are listed, as well as the changing techniques
of presentation, costumes, stage props and concepts of individual characters
as expressed in the course of the four hundred years from the Elizabethans
to the present.
...
The first work discussed is an octagonal base that most
likely served as the pedestal of a sun dial. It was erected as a monument
to Shakespeare in his own garden at New Place, Stratford. The sculptures
in relief on the base show seven weather-beaten but still recognizable
scenes from ”The Seven Ages of Man” (As You Like It, II,7)
together with the initial lines of the monologue ”All the World’s
a Stage”. There are good reasons for assuming that either Shakespeare
himself or his family put up the monument to his lasting memory. So it
is remarkable, to say the very least, that the monument disappeared almost
immediately after its discovery in 1996, when it was first investigated,
photographed and recorded for posterity by the author.
The second example from Shakespeare’s own lifetime
is Henry Peacham’s famous and controversial ”Illustration
of Titus Andronicus”. The author dates it to either 1594 or 1595
and classifies it as a stage drawing of the entrance scene with Shakespeare
in the role of the title hero and Tamora played by Richard Burbage. The
identifications are based on evidence from picture comparisons as used
in modern criminal investigation. They are part of a report of the year
1995 by an expert of the German Bureau of Criminal Investigation (Bundeskriminalamt).
The facial mimics and gestures in the body language of the actors, their
positioning on the stage and the spacing correspond exactly to their roles
and are in agreement with baroque stage directions as formulated in the
Dissertatio de actione scenica, published by D. Franciscus Lang in 1727.
These examples cannot do justice to the range of information in the work
and to the methodological subtlety employed by the author in her investigation,
but may serve to indicate the richness and precision of her research.
The general evidence of the illustrations from the late 16th century up
to the year 2000 shows that individual portraits as well as genre paintings
have merged with representations on the stage as historical subjects.
...
Die Shakespeare-Illustration is a great work and a rare
achievement of intelligence and devotion to Shakespeare in the sculptured
landscape garden of German academe. Each illustration selected by the
author bears witness to an important and probably undying moment in Shakespeare’s
plays. The author has seen to it that each illustration retains its singular
status and, at the same time, contrives to remain an artifice embodying
the rich flavour of its own age. In this way, the author has produced
a marvellous survey of European cultural history, a treasure hoard of
inestimable value. The author’s comments are always succinct, constructive
and well-balanced. She may have her favourites, but her comments show
an intense and impartial critical spirit. True understanding is always
more important than critical bias. Those who teach English as a foreign
language are gradually becoming aware of the European history of ideas
and its central importance. The first two decades of literary studies
after the war were marked by comparative studies (Friedrich, Auerbach,
Spitzer, Curtius, Clemen, Eliot, Lovejoy, Welleck/Warren, Hocke, Hazard,
de Rougement, Trilling, E. Wilson, H. Levin and others). The last two
decades have seen the triumph of social studies, linguistics and a growing
specialization in which very often all cultural orientation was lost.
This book treats ideas as ”central objects” (Whitehead) and
tries to re-establish the ‘long traditions’ that have created
Western culture and very often support our own cultural identity. Along
with the study of Shakespeare’s plays the illustrations not only
directly illuminate our own imaginative understanding of 400 years of
history, but appeal to our own sense of trust, confidence and individual
achievement. This book may be expensive, but if we trust its message,
it can open our eyes to a new appreciation of our past history and direct
our experience of the present.”
***
Auszug aus der Besprechung des
Anglisten und Journalisten Tobias Döring in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung (2. Dezember 2003):
“Vor mehr als vierzig Jahren faßte der Marburger
Anglist Horst Oppel den Plan, Bilder, die von Shakespeare-Dramen angeregt
wurden, umfassend zu dokumentieren, um sie, genau wie Produktionen für
die Bühne, als eigenwertige Deutungen der Texte zu erschließen.
Das Forschungsprojekt wurde nach seinem Tod von Schülern fortgeführt,
maßgeblich von Hildegard Hammerschmidt-Hummel in Mainz, die es seit
zwei Jahrzehnten mit der ihr eigenen Entschiedenheit verfolgt hat. Jetzt
ist es - vorerst jedenfalls - zu einem Abschluß gekommen, und der
Ertrag ist eine Augenlust. Dreitausend Illlustrationen von 550 Künstlern
aus Westeuropa und Nordamerika (Schwerpunkte sind England, Frankreich,
Deutschland) werden dargeboten, katalogisiert und kommentiert sowie durch
Künstlerbiographien, Bibliographien und Register zugänglich
gemacht. Und da die Abbildungen sämtlich in Schwarzweiß vorliegen,
bleibt so der individuellen Phantasie noch reichlich Raum zur Ausmalung.
Die Anordnung der Bilder ist nicht chronologisch, sondern
folgt den 37 Stücken und hält sich überdies genau an deren
Szenenfolge. Durch diese schöne Konzeption sehen wir jede Figur dutzendfach
vervielfältigt, und jede Szene erscheint wie im Kaleidoskop. [...]
Obwohl oftmals durch Familienähnlichkeit verbunden, blicken uns die
vertrauten Charaktere in faszinierender Verfremdungsfülle an. Der
Bühnenjude Shylock erscheint mal als hakennasige Grimasse, mal als
grimmer Vater, mal als geschundene Kreatur. Die Verschwörer gegen
Cäsar setzen ihren blutigen Entschluß mal, wie bei Wilhelm
von Kaulbach, mit kraftvoller Theatralik ins Werk, mal wie in wirrer Panik
und mal in trostloser Verlorenheit. Immer aber sind die Bilder vor allem
ein Beweis der vielsagenden Vorahnung, die Shakespeare seinen Cäsar-Mördern
selbst in den Mund legt: ‘In wieviel Zukunftszeiten / Wird wohl
noch diese unsre Szene nachgespielt!’ So können ansonsten wohl
nur Götter auf die Weltgeschichte schauen: In jeder Darstellung gewahren
wir, sie sich längst Vorhergeschriebenes neu vollzieht.
Daher hält dieses fabelhafte Shakespeare-Memory
die eigentlichen Entdeckungen dort bereit, wo gänzlich unbekannte
Szenen vorgespielt werden. Manche Bilder zeigen nämlich, was die
Bühne stets verbirgt. Auf dem Gemälde, das die Berliner Malerin
Gisela Breitling 1985 für den Wettbewerb ‘Images of Shakespeare’
schuf, sehen wir Ophelia in einer Pose wie sonst nie: als ruhenden Akt
in freier Landschaft, die fast den Körperrundungen zu folgen scheint,
voll erotischer Kraft und vollkommen bei sich - ein starkes Gegengewicht
zur bleichen Wasserleiche der Hysterikerin wie in traditioneller Ikonographie.
[...] Mit jeder Seite, die wir aufschlagen, erwacht eine
Geschichtenwelt zu wundersamem Eigenleben, quillt wuchernd aus dem Buch
hervor und macht jeden Betrachter gleich zum Mitspieler. Herzog Prospero
ging ins Exil, weil er die Bücher mehr als die Macht schätzte.
Für dergleichen Bilderbuchschätze würden allerdings auch
wir jedes Herzogtum gerne hergeben.”
***
Auszug aus dem Hörfunkprogramm
“Literatur im Land”, Südwestrundfunk (SWR2): “Shakespeare
und kein Ende” - Hildegard Hammerschmidt-Hummels Shakespeare-Biographie
und ihre Bücher zur Shakespeare-Illustration (1594-2000) - Eine Sendung
von Stefan Ringel (23. August 2003):
“Hammerschmidt-Hummel hat in diesem Jahr [...]
nicht nur eine Shakespeare-Biographie vorgelegt [siehe ‘Bücher’:
William Shakespeare. Seine Zeit - Sein Leben - Sein Werk, Mainz: Philipp
von Zabern]. Gleichzeitig erschien im Harrassowitz Verlag auch noch ein
weiteres Resultat langjähriger Arbeit: Eine dreibändige Publikation
zur Geschichte der Shakespeare-Illustration. Die Arbeiten an diesen umfangreichen
Bildbänden wurde maßgeblich von der Akademie der Wissenschaften
und der Literatur in Mainz unterstützt:
Die dreiteilige Bilddokumentation Die Shakespeare-Illustration ist als Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Akademie
der Wissenschaften und der Literatur in Mainz aus dem sogenannten Shakespeare-Bildarchiv
hervorgegangen. [...] dieses Shakespeare-Bildarchiv wurde von meinem verstorbenen
Lehrer Professor Horst Oppel - er war ein großer Goethe-Forscher
und ein großer Shakespeare-Forscher - [...] in den Nachkriegsjahren
hier in Mainz aufgebaut.
Die Mainzer Anglistin begnügte sich nicht damit,
die zahlreichen Funde in einem Buch zusammenzutragen, sondern hat diese
Publikation auch mit vielen hilfreichen Ergänzungen versehen.
[...] ich habe mich [...] entschlossen, nicht nur
dieses Kernstück zu erarbeiten, was jetzt auch das Kernstück
der Publikation bildet, sondern ich habe dem ganzen [...] auch eine große
Bibliographie beigegeben, ich habe ein Künstlerlexikon mit 550 Einträgen
verfaßt und [...] eine Geschichte der Shakespeare-Illustration [geschrieben]
mit besonders markanten Beispielen. [Die Bilddokumentation] wird abgerundet
mit Registern [...] zur Erschließung des Werks, nämlich Künstler-Register,
Stecher-Register, ein Register der Schauspieler und der Shakespeare-Figuren.
Auf diese Weise ist ein Nachschlagewerk entstanden, das
für einen großen Personenkreis interessant ist: Der Kunstinteressierte
kann durch das Künstler-Register rasch erfahren, wer Shakespeare-Illustrationen
angefertigt hat. Der Theaterinteressierte kann anhand der Illustrationen
die Wandlungen in den Darstellungsformen nachvollziehen. In einem ausführlichen
Aufsatz im ersten Band hat Hammerschmidt-Hummel darüber hinaus einen
Abriß der Geschichte der Shakespeare-Illustration gegeben und zahlreiche
eigene Deutungen und Interpretationen der Kunstwerke vorgelegt.
[Auszüge aus ‘Geschichte, Funktion und Deutung
bildkünstlerischer Werke zu Shakespeares Dramen’:]
[Auszüge aus: ‘Geschichte,
Funktion und Deutung bildkünstlerischer Werke zu den Dramen William
Shakespeares’]
‘Juliet and her Nurse’ - Ölgemälde
von William Turner aus dem Jahre 1836:
Wie kein anderer [...]Maler vor ihm setzte sich Turner
über alle Grundregeln der konventionellen Historiendarstellung hinweg.
So siedelt er die Shakespearesche Titelheldin Juliet (zusammen mit ihrer
Amme) nicht nur am extremen rechten Bildrand an und zeigt sie lediglich
im Profil, sondern läßt sie überdies auch klein und unbedeutend
erscheinen vor der beherrschenden Kulisse von San Marco. Diese figürliche
Reduktion verstößt gegen die erste Grundregel der klassischen
Geschichtsmalerei, derzufolge der Held bzw. die Heldin das Bildzentrum
besetzt. Mehr noch: Nicht der große, heroische Moment der Bewährung
und Prüfung, der alles entscheidende Augenblick einer ‘erzählten’
Geschichte wird thematisiert, sondern ein sekundäres, eher unscheinbares
Geschehen. [...] Die auffälligste Abweichung aber gegenüber
der tradierten Historienmalerei, insbesondere jedoch gegenüber der
literarischen Vorlage, ist die willkürliche Verlagerung des Schauplatzes
von Verona nach Venedig. Historisch-literarische Treue und Authentizität
scheinen Turner nicht im geringsten zu kümmern. [...] Als Erklärung
für den eklatanten Verstoß gegenüber seiner literarischen
Quelle bieten sich (abgesehen von der persönlichen Vorliebe des Künstlers
für diese Stadt) vornehmlich zwei Motive an.
(1) Es war Venedig, nicht Verona, das - ähnlich
wie die Alpen - der Vorstellung Turners vom Erhabenen in besonderer Weise
entsprach. [...]
(2) Mit ‘Juliet and her Nurse” hat Turner
eine Ansicht von Venedig gewählt, die zugleich unverkennbare sexualsymbolische
Zeichen im Sinne Sigmund Freuds setzt. Die Kuppeln, Wölbungen und
Bögen von San Marco und der sich pfeilartig erhebende Campanile werden
durch die Umrißlinien des 1842 entstandenen Stichs sogar noch stärker
konturiert als in Turners Original [...]. Der weißlich-gelb getönte
Himmel erzeugt eine unwirkliche Stimmung, in der Spuren von Auflösung
und Sterben spürbar werden, so wie sie auch in Shakespeares Stück
an den verschiedensten Stellen szenisch oder bildsprachlich anzutreffen
sind. So offenbart das Bild, indem es die Freudsche Sexualsymbolik antizipiert
und mit seiner völlig neuartigen Maltechnik unterschwellig eine Atmosphäre
des Verfalls auszudrücken vermag, auf geniale Weise die auch der
Shakespeareschen Tragödie zugrundeliegende und in Variationen immer
wieder anklingende Eros-Thanatos-Motivik.
‘Sommernachtstraum’ - Ölgemälde
von Max Slevogt aus dem Jahre 1922:
Wenn von Slevogt behauptet wurde, er habe sich einem
literarischen Werk ‘mit großem Einfühlungsvermögen
und entfesselter Lust am Zeichnen’ genähert, so trifft dies
in besonderer Weise auch für seinen Umgang mit Werken William Shakespeares
zu. Sein Gemälde ‘Der Sommernachtstraum’ [...], das die
Liebesszene zwischen Bottom und Titania in IV, 1 in eine impressionistische
Landschaftsdarstellung einbettet, in der die Figuren in den Hintergrund
treten und die Welt der Elfen und Feen in der farbenfreudigen Flora des
Bildes nur angedeutet werden, ist eine grandiose Verbildlichung der berühmten
Shakespeare-Szene. Mit seiner flüchtigen und virtuosen Pinselführung
und seiner hellen, von der französischen Pleinairmalerei angeregten
Farbpalette weist sie typische Merkmale des Slevogtschen Impressionismus
auf und gehört zu den Meisterwerken der jüngeren Shakespeare-Malerei.
‘Lady Macbeth’ von Salvador
Dalí aus dem Jahre 1946:
Dalí, der mittels seiner paranoisch-kritischen
Methode seine eigenen ‘halluzinatorischen Fähigkeiten aufs
äußerste zu steigern und sich in einen tranceartigen, hysterischen
paranoia-ähnlichen Zustand’ zu versetzen vermochte, um alogischen
und traumhaften Bildern und Visionen auf die Spur zu kommen, hat mit Vorliebe
jene Shakespeare-Stücke als Vorlage bildkünstlerischer Gestaltung
gewählt, in denen nicht nur Träume, sondern auch psychische
Störungen, Wahnsinn und Visionen eine entscheidende Rolle spielen.
Dies wird auch an seiner Darstellung der Lady Macbeth [...] deutlich,
deren bildliche Zeichen weit über das verbale Figurenporträt
der [...] [Szene II, 2] hinausgreifen. Sie signalisieren eine psychische
wie physische Symptomatik, die der Figur erst in V, 1-5 eigen ist. Dalí
bedient sich hier - mit großer affektiver Wirkung - der Möglichkeiten
der ikonischen Simultanäußerung. Er zeigt im wörtlichen
Sinne eine gespaltene Lady Macbeth, eine paranoid-schizophrene Persönlichkeit.
Die rechte Kopfhälfte spiegelt mit stark hervorspringendem Auge die
ganze Gier, Skrupellosigkeit und Machtbesessenheit, von denen die Figur
hier noch vollends beherrscht wird, während die linke Hälfte
sie bereits im Zustand jener geistigen Verwirrung bzw. paranoiden Schizophrenie
zeigt, die bei Shakespeare erst am Ende des Stückes in V, 1 manifest
wird und sich in Form von Halluzinationen [...] oder Zwangshandlungen
[...] sowie ihrem pathologischen Verlangen, unaufhörlich von Licht
umgeben zu sein, niederschlägt.
Natürlich hat die Mainzer Anglistin Hildegard Hammerschmidt-Hummel
unter den etwa [...] [3000] Illustrationen zu William Shakespeares Werken
auch ihre persönlichen Favoriten:
Selbstverständlich hat man [...] eine ganze
Reihe von Illustratoren, deren Werke man ganz besonders schätzt,
die einem sozusagen [...] ans Herz gewachsen sind. Ich muß vorab
sagen, daß mich insbesondere auch die sogenannten Shakespeare-Galerien
[...] fasziniert haben. Etwa die berühmte Shakespeare Gallery von
John Boydell. [Boydell] war ein reicher Verleger und Kupferstecher, der
gegen Ende des 18. Jahrhunderts lebte und der sich zum Ziel gesetzt hatte,
auf der Basis der Dramen Shakespeares, nicht nur der Historien, sondern
der gesamten Dramen, eine englische Historienmalerei zu begründen.
Und er hat [...] Johann Heinrich Füssli gewinnen können. Unter
anderem war ihm natürlich sehr [daran] gelegen, die Honoratioren
mit einzubeziehen, etwa den Präsidenten der Royal Academy, Sir Joshua
Reynolds. [Reynolds] hat er gleich 500 Pfund bar auf die Hand gegeben
und gesagt, er könne jeden Preis fordern, er [Boydell] würde
ihn zahlen, wenn er [Reynolds] sich an dem Projekt [beteilige]. Und Reynolds
hat sich beteiligt. Der beste unter den Boydell-Malern ist nach meiner
Meinung Johann Heinrich Füssli. Füssli ist - wie schon Goethe
sagte - ‘Shakespeares Maler’. Ein weiterer Maler ist William
Turner. Und Turner hat - wie Füssli - auf dem Gebiet der Shakespeare-Illustration
Maßstäbe gesetzt.
Neben Namen wie Füssli, Turner, Slevogt und Dalí wird der Betrachter noch auf zahlreiche
weitere bekannte Künstler aller Epochen stoßen. Ihr Interesse
am Werk William Shakespeares bezeugt die ungebrochene Aktualität
seiner Dramen. Auch in Zukunft wird daher das Motto ‘Shakespeare
und kein Ende’ seine Gültigkeit behalten.”
***
Auszug aus der Rezension Alexander
Mendens in der Süddeutschen Zeitung (23. April 2003):
“Nur die Bibel und die antiken Mythen haben motivgeschichtlich
einen größeren Einfluß auf die westliche Kunst der vergangenen
vier Jahrhunderte gehabt als das Shakespeare-Universum. Die Mainzer Anglistin
Hildegard Hammerschmidt-Hummel legt nun in Fortführung eines von
ihrem Lehrer Horst Oppel bereits 1976 begonnenen Projektes ein dreibändiges
Kompendium zur ‚Shakespeare-Illustration 1594-2000’ vor. Die
Kompilation von 3000 ‚bildkünstlerischen Darstellungen’
ist der Versuch der repräsentativen Auswahl aus einem weit umfangreicheren
Fundus.
Der vorliegende Extrakt beeindruckt, was Fülle und
großenteils auch Qualität der Kunstwerke betrifft: Unter den
rund 550 Künstlern finden sich Namen wie Hogarth, Füssli, Rossetti,
William Blake, Delacroix, Dalí und Kokoschka. Im zweiten und dritten
Band sind, in der Reihenfolge des ersten Folios, Illustrationen der Stücke
nach ihren einzelnen Szenen zusammengestellt; … Zusätzlich
ist jedem Drama eine Sektion mit Figuren-und Schauspielerporträts
beigegeben. Diese von der Herausgeberin der ‚Shakespeare-Illustrationen’
verrichtete Fleißarbeit verdient Respekt. Sichtung und Auswahl der
Bilder stellen eine beachtliche Leistung dar. Hilfreich sind auch die
umfangreiche Bibliografie, die Bildlegenden, sowie das Lexikon im Anhang
des ersten Bandes, das in konzisen biografischen Abrissen sämtliche
Künstler vorstellt.”
***
Auszug aus der Besprechung des
Verbands deutscher Antiquare, Buchkunde - Verband deutscher Antiquare
e. V. www.antiquare.de/de/buchkunde.asp
Buch des Monats - März [2003]
Viele berühmte Künstler haben sich als Shakespeare-Illustratoren
versucht, unter ihnen Inigo Jones, Hogarth, Blake, Turner, Schinkel, Cornelius,
Menzel, Feuerbach, Rossetti, Millais, Delacroix, Manet, Whistler, Slevogt,
Redon, Mucha, Beardsley, Nolde, Marc, Lehmbruck, Beckmann, Kokoschka,
Dalí und Chagall. Die ältesten Bühnenzeichnungen zu Shakespeares
Dramen reichen sogar bis in das elisabethanische Zeitalter zurück:
Sie zeigen seinen ersten großen Darsteller und offenbar - Shakespeare
selbst. …
Diese Illustrationen hat die Herausgeberin der dreibändigen
Bilddokumentation gesammelt, katalogisiert, in der Reihenfolge der First
Folio von 1623 geordnet, den einzelnen Akten und Szenen zugeteilt und
interpretiert. Das Kernstück des Buches bildet der Katalogteil mit
nahezu 3100 Darstellungen, die rund 550 Künstler von 1594 bis zum
Jahr 2000 angefertigt haben. Ein Künstlerlexikon, eine Bibliographie
sowie ein Abriss zur Geschichte der Shakespeare-Illustrationen machen
das Kompendium für Bibliophile und Antiquare zum unentbehrlichen
Nachschlagewerk.
Hildegard Hammerschmidt-Hummel ist eine ausgewiesene
Shakespeare-Kennerin, die sich durch jahrelange Forschungstätigkeiten,
als Leiterin des Shakespeare-Bildarchivs in Mainz und zahlreiche Publikationen
zum Thema einen Namen gemacht hat. Zeitgleich zum dreibändigen Werk
erscheint von ihr im Zabern-Verlag eine neue Biographie über den
großen englischen Dramatiker unter dem Titel “William Shakespeare:
Seine Zeit, sein Leben, sein Werk”.
***
Stellungnahme von Professor em.
Dr. phil. Dieter Wuttke, Universität Bamberg, vormals Mitglied des
Institute for Advanced Study in Princeton, Visiting Fellow, CASVA, National
Gallery of Art, Washington:
”Die neuen Forschungsmethoden der Autorin und ihre auf diese Weise
gewonnenen Ergebnisse bedeuten einen Triumph kulturwissenschaftlich gelenkter
Philologie. Sie hätten auch die begeisterte Zustimmung eines Aby
M. Warburg oder Erwin Panofsky gefunden.”
***
Erwähnung des Projekts im Lexikon der Kunst (München: dtv, 1996 - Leipzig: Seemann,
1994), Bd. 6, s. v. “Shakespeare-Illustrationen”, S. 631-632.
*** |
e. Repliken / Replies
Replik auf Sibylle Ehringhaus,
“Hildegard Hammerschmidt-Hummel (Hg.): Die Shakespeare-Illustration
(1594-2000). Bildkünstlerische Darstellungen zu den Dramen William
Shakespeares: Katalog, Geschichte, Funktion und Deutung, Wiesbaden: Harrassowitz
2003, 3 Bde., 1568 [sic] S., 3100 Abb., ISBN 3-447-04626-0, EUR 228,00”
in Sehepunkte - Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften - 4 (2004) Nr. 4
http://www.sehepunkte.de/2004/04/c3927.html
Fast jeder Satz der vorliegenden Besprechung offenbart, daß Sibylle
Ehringhaus es darauf angelegt hat, die dreiteilige Bilddokumentation Die
Shakespeare-Illustration (1594-2000) herabzusetzen. Die Herausgeberin
und Autorin sollte dazu eigentlich schweigen und das Werk für sich
sprechen lassen. Gleichwohl sieht sie sich zur Replik genötigt. Denn
in ihrem Eifer, aufzeigen zu wollen, daß das Opus keine “repräsentative
Bilddokumentation” sei und nicht “kunst- und literaturwissenschaftlichen
Kriterien” genüge - verwickelt sich die Rezensentin in große
Widersprüche. Das beginnt schon damit, daß sie am Anfang affirmativ
konstatiert, jetzt liege “eine Publikation vor, die man ohne zu
zögern in Anspruch, Ausstattung und Umfang und Gestalt ein Opus magnum
nennen kann”. Das als Opus magnum gepriesene Werk wird anschließend
jedoch mit abwertender Absicht als bloße “Kompilation”
eingestuft. Bekanntlich hat eine Kompilation per definitionem wissenschaftlich
praktisch keinen Wert.
Doch welcher Art sind die Beanstandungen, die eine solche
Herabstufung rechtfertigen? In den Augen der Rezensentin wurde eine Aufteilung
gewählt, “die schlichter und uninspirierter kaum vorstellbar
ist”. Damit meint Ehringhaus die Gliederung der Bände und die
Anordnung des Bildmaterials. Über beides haben die Projektleiter
(Prof. Rudolf Böhm, Kiel, Prof. Horst W. Drescher, Mainz, und Prof.
Paul Goetsch, Freiburg), der Kommissionsvorsitzende der Mainzer Akademie,
Prof. Werner Habicht, mehrere DFG-Gutachter, darunter zwei Kunsthistoriker,
und die Herausgeberin lange und intensiv beraten. Klar wurde "zugunsten
einer Zuordnung der Bilder zum dramatischen Werk Shakespeares" entschieden,
"und zwar nach ‘Drama’, ‘Akt’ und ‘Szene’”
(“Notate der Herausgeberin”, Teil I, XIX). Dies ermöglicht
es dem Benutzer, ganze Shakespeare-Dramen parallel zum Text 'bildlich
zu lesen’. Ehringhaus aber übt daran gleichwohl heftige Kritik.
Ihre nicht nachvollziehbare Begründung lautet, eine solche Zuordnung
lasse es nicht zu, “über die Bilder vergleichend zu reflektieren”.
Immerhin bestätigt sie, der erste Band enthalte - wie sie es nennt
- “den Anteil der Reflexion”. Am Ende aber gelangt sie zu
dem Urteil, die Reflexion fehle gänzlich und dies sei ein großes
Manko des Werks.
Am Künstlerlexikon bemängelt die Rezensentin,
dort seien die “Shakespeare-Darstellungen des jeweiligen Künstlers
nur faktisch und nicht einmal vollständig erwähnt”. Daß
die ‘vollständige Erwähnung’ der Shakespeare-Illustrationen
eines Künstlers im Lexikon gar nicht möglich ist, fällt
ihr nicht auf. Dabei hätte schon ein Blick auf das Künstlerregister
genügt, um ihr zu zeigen, daß viele dieser Einträge so
zahlreiche Bildverweise enthalten, daß ihre (Ehringhaus’)
Forderung absolut unrealistisch ist.
Unangenehm berührt, daß Ehringhaus einen Vorzug
des Lexikons irrtümlicherweise als Mangel deutet und - von dieser
falschen Voraussetzung ausgehend - seinen “wissenschaftlichen Wert”
in Frage stellt. “Entlarvend”, so betont sie, habe die Herausgeberin
selbst erklärt: “Rund 15 Prozent dieser Viten sind in den Standard-Nachschlagewerken
nicht verzeichnet” (Teil I, XXIII). Sollte der Rezensentin tatsächlich
entgangen sein, daß gerade diese Einträge von besonderem Nutzen
sind und zeit- und kostenintensive Recherchen nötig waren (etwa in
der British Library, im Britischen Museum u. a.), um einschlägige
Quellen, darunter handschriftliche Künstler-Listen und -Verzeichnisse
früherer Jahrhunderte, aufzuspüren und sie später in mühseliger
Kleinarbeit auszuwerten? Auf der Suche nach biographischen Angaben über
Maler, Musiker, Schriftsteller etc. ist man im allgemeinen für jeden
noch so kleinen Hinweis dankbar. Und wenn das Künstlerlexikon des
Werks Die Shakespeare-Illustration nun eine ganze Reihe von Einträgen
enthält, die man in den Standardlexika nicht findet, kann man dies
- bei objektiver Betrachtung - wohl kaum als Manko bewerten. Natürlich
ist es auch kein Mangel, daß die Künstlerviten knapp gefaßt
sind, was aber von Ehringhaus gleichfalls beanstandet wird. Wenn sie zudem
meint, die Viten gingen “nicht über die biografischen Eckdaten
hinaus”, so ist dies schlichtweg falsch. Ich zitiere aus den “Notaten
der Herausgeberin”: “Die Strukturierung der Einträge
des Lexikons erfolgte, sofern bekannt, prinzipiell nach den Gesichtspunkten:
(1) Ausbildung des Künstlers, Lehrer, künstlerische Prägung,
(2) Einflüsse auf die künstlerische Entwicklung (Reisen, Kontakte,
literarische Vorlieben), (3) Hauptwerke, (4) Auszeichnungen, (5) Ausstellungsorte,
(6) stilistische Einordnung des künstlerischen Werks, (7) Wege des
Künstlers zur literarischen Illustration, (8) Beziehung des Künstlers
zum Theater, (9) Auseinandersetzung des Künstlers mit dem Werk Shakespeares”
(Teil I, XXIII).
Keiner der von Ehringhaus vorgebrachten Kritikpunkte
hält einer Überprüfung stand. Die abschließenden
Äußerungen der Rezensentin sind persönliche Meinungsbekundungen,
die durch keinerlei Sachargumente untermauert werden und zudem völlig
unzutreffend sind: “Man kann diese Sammlung”, so Ehringhaus,
“wissenschaftsgeschichtlich in den Positivismus des 19. Jahrhunderts
verorten.” Ferner meint sie, “die Arbeit [bleibe] ganz und
gar unberührt von aktuellen Diskursen, wie der Rezeptionsgeschichte
eines Gary Taylor beispielsweise.” Dem ist entgegenzuhalten, daß
in “Geschichte, Funktion und Deutung bildkünstlerischer Werke
zu Shakespeares Dramen” (Teil I) selbstverständlich, soweit
dies möglich war, neueste Ansätze und Konzepte berücksichtigt.
Wenn die Rezensentin dann auch noch auf Gary Taylors Buch Reinventing
Shakespeare. A Cultural History from the Restoration to the Present (1990)
verweist - gleichsam als Musterbeispiel, an dem die Herausgeberin/Autorin
sich hätte orientieren sollen -, muß sie sich allerdings fragen
lassen, ob sie mit diesem Werk überhaupt vertraut ist. Taylors interessante,
aber recht salopp verfaßte Kulturgeschichte - der Titel der deutschen
Übersetzung lautet: Shakespeare - Wie er euch gefällt. Geschichte
einer Plünderung durch vier Jahrhunderte - wäre für die
Arbeiten am Projekt “Die Shakespeare-Illustration” mit Sicherheit
kontraproduktiv gewesen. Denn den Autor interessieren, wie er selbst sagt,
Fragen nach der “kulturellen Vorherrschaft” des Dichters wie
beispielsweise: “Wann wurde Shakespeare zum größten englischen
Dramatiker erkoren? Zum größten englischen Dichter? Zum größten
Dichter aller Zeiten?” (11). Sein Hauptanliegen formuliert Taylor
am Ende seiner Einleitung: “Die Geschichte des wachsenden Shakespeare-Ruhmes
muß deshalb die Annalen der Shakespeare-Kritik, des Theaters und
vieler anderer Bereiche einbeziehen. Das gesamte Fach ist so umfassend,
daß es dafür keinen Namen gibt. Da wir einen Namen brauchen,
taufen wir es ‘Shakespearotik’” (12).
Auch der Ratschlag, den Ehringhaus zu guter Letzt nicht
nur der Herausgeberin, sondern praktisch allen am Projekt Beteiligten
erteilt, ist in mehrerer Hinsicht unangebracht: Das “damals von
Horst Oppel zusammengestellte Material”, so argumentiert die Rezensentin,
hätte man besser als “work-in-progress” belassen und
“der Öffentlichkeit im Internet” anvertrauen sollen.
Dies, so urteilt sie apodiktisch, wäre “dem Ansehen der Mainzer
Akademie” zugutegekommen. Daß die Mainzer Akademie der Wissenschaften
aber gerade den traditionellen Publikationsweg gewählt hat und den
Traditionsverlag Harrassowitz damit betraute, stört sie nicht. Die
Erkenntnis, daß man seine wertvollen Schätze - und um solche
handelt es sich hier - indessen nicht einfach verschleudert, sondern in
angemessener Form und unter Berücksichtigung der Willensbekundungen
des Archivgründers präsentiert, kommt ihr nicht. Zudem hätte
Ehringhaus, zumal in ihrer Eigenschaft als Kunsthistorikerin, eigentlich
wissen müssen, daß ebenso wie für die vorliegende Publikation
auch für eine Internetpublikation der immens zeitaufwendige und komplizierte
Prozeß des Einholens der Bildrechte nötig gewesen wäre,
daß aber in letzterem Fall zahlreiche Eigentümer ihre Rechte
wohl gar nicht erteilt hätten.
Abschließend sollte nicht unerwähnt bleiben,
daß die Einwände der Rezensentin - ihre Kritik an der Zuordnung
und Einteilung des Bildmaterials und am Künstlerlexikon, ihre Empfehlung
des Ansatzes von Gary Taylor, ihr Anraten einer Internetpublikation u.a.
- in erstaunlicher Weise mit jenen Kritikpunkten übereinstimmen,
die DFG-Gutachter aus Berlin und München schon vor Jahren vorbrachten,
die damals jedoch einvernehmlich ausgeräumt wurden. Dem erfolgreichen
Abschluß des Projekts in drei Bänden mit insgesamt 1772 Seiten
(nicht 1568, wie Ehringhaus angibt) stand seither nichts mehr im Weg.
***
Replik auf Alexander Menden, “Das
Kriminalgutachten. Eine schwierige Edition der Shakespeare-Illustrationen”, Süddeutsche Zeitung (23.04.03):
Mendens Rezension beginnt mit einem großen Mißverständnis.
Mit “charakteristischer Bestimmtheit” habe der Dramatiker
Ben Jonson den Lesern der ersten Werkausgabe Shakespeares geraten: “Nicht
das Bild solle man betrachten, sondern das Buch.” Die dem Droeshout-Stich
der ersten Werkausgabe Shakespeares beigefügten Zeilen von Ben Jonson
sind jedoch zuvorderst - wie in der Renaissance üblich - eine Identitätsbeglaubigung.
Folglich lautet derAuftakt: “Das Bildnis beigefügt allhier,
/ Den edeln Shakespeare zeigt es dir”. Da es dem Künstler indessen
nicht möglich sei, auch den Geist (“wit”) des Dichters
wiederzugeben, rät Jonson, eine glänzende Brücke zum Buch
schlagend, zur Lektüre des Werks. Mendens Schlußfolgerung,
Jonson habe den Porträtstich als “unvollkommen” verworfen,
ist daher völlig verfehlt - ebenso wie seine Mutmaßung, der
Stich habe “zu allerlei Spekulationen” um “die Identität
des Autors” geführt. Denn die unbegründete Suche nach
einem anderen Autor entzündete sich - wie das Beispiel Delia Bacon
zeigt - an der Büste des Dichters in der Kirche zu Stratford, die,
im englischen Bürgerkrieg von Puritanern demoliert, mit viel zu kurzer
Nase wieder hergerichtet wurde und seither keine Ausstrahlung mehr besaß.
Da Menden keine stichhaltigen Einwände bzw. Gegenargumente vorbringt,
ist seine an drei Beispielen festgemachte Kritik leicht widerlegbar.
(1) Im Falle von Peachams Federskizze zu Shakespeares Frühwerk Titus
Andronicus aus dem Jahre 1594, in diesem Jahr mehrfach in London gespielt,
war es mir möglich, anhand eindeutiger Kriterien (Wiedergabe individueller
Personen mit bunt zusammengewürfelten Kostümen, teils historisierend,
teils elisabethanisch, theatralische Choreographie, Anlehnung an den Normenkatalog
der gestischen Zeichen des Barocktheaters u.a.) erstmals nachzuweisen,
daß der Künstler eine Aufführung mitgezeichnet haben muß,
so daß wir es hier mit elisabethanischen Schauspielern zu tun haben.
Meine sorgfältig durch Bildvergleiche erarbeitete These, in der weiblichen
Hauptrolle der Gotenkönigin Tamora sei Shakespeares erster großer
Darsteller, Richard Burbage, und in der Titelrolle Shakespeare selbst
wiedergegeben, trug ich im Januar 1995 der zuständigen Kommission
der Mainzer Akademie der Wissenschaften vor und informierte die Mitglieder
von meiner an den Präsidenten des Bundeskriminalamts gerichteten
Bitte, meine These mittels Testverfahren zur Identitätsfeststellung
bildlich dargestellter Personen zu überprüfen. Die von den zuständigen
BKA-Experten durchgeführte Identitätsprüfung, bei der der
vergrößerte Kopf der Tamora mit einem authentischen Burbage-Porträt
verglichen wurde, erbrachte ein positives Ergebnis: Sechs Gesichtsmerkmale
stimmten überein; eine Abweichung konnte nicht festgestellt werden.
Wenn Alexander Menden dem Leser das umfangreiche Bildgutachten des BKA-Sachverständigen
vom 03.05.1995, in dem der vorliegende Fall als erster gelöst wurde,
verschweigt, die wissenschaftlich exakte Vorgehensweise der Verfasserin
als “verwegen” abtut und ins Lächerliche zieht, so kann
man ihm dabei wohl kaum folgen.
(2) Auch Mendens zweiter Kritikpunkt erweist sich als gegenstandslos.
Er entzündete sich an meiner Aussage, Hogarth statuiere mit seiner
Darstelllung des David Garrick als Richard III. “ein Exempel für
eine zukunftsweisende Theatermalerei”. Ich konnte mich dabei auf
die jüngere und jüngste Hogarth-Forschung stützen. Der
Rezensent, dem dies entging, maßt sich eine sinnentstellende und
parodistische Umschreibung dieses Satzes an, der viel über ihn selber
aussagt. Dies gilt auch für die schmähenden Äußerungen
des Rezensenten hinsichtlich der Ergebnisse des Buches Das Geheimnis um
Shakespeares ‘Dark Lady’. Indem er ein kleines (absolut logisches)
Nebenergebnis Prinzessin Diana betreffend hochspielt und ridikülisiert,
zeigt er, daß er das Buch entweder nicht gelesen oder die Beweisführung
nicht verstanden hat bzw. nicht verstehen möchte. Ich rate zur Lektüre
der ausführlichen Diskussion in der Anglistik (September 2000), dem
Fachorgan der deutschen Hochschulanglisten, aber auch der stilistisch
und inhaltlich anspruchsvollen Besprechung von Esther Knorr-Anders in
der SZ vom 10.11.1999.
(3) Was Menden über Boydells Shakespeare Gallery an Kritik vorbringt,
verschlägt dem Kenner die Sprache. Es fragt sich, ob sich der Rezensent
mit diesem Kernstück des einleitenden Teils “Geschichte, Deutung
und Funktion der bildkünstlerischen Darstellungen zu Shakespeares
Dramen” überhaupt befaßt hat. Denn dort unterstellt er
der Autorin, “die Werke der Boydell-Sammlung als ‘subjektivistisch’
und ans ‘Rührselige’ grenzend” eingestuft zu haben.
Sie hätten daher den Kriterien der Historienmalerei nicht genügt.
Zur Richtigstellung sei hier der Schluß dieses Unterkapitels angeführt:
“Die Arbeiten zu Boydells Shakespeare-Gallery sind überwiegend
rückwärtsgewandt, orientieren sich an der konventionellen Historienmalerei
und ordnen sich zuweilen allzu sehr dem Diktat des Mäzens unter.
[...] Wenn John Boydell auch sein eigentliches Anliegen [die Etablierung
einer englischen Historienmalerei auf der Basis der Dramen Shakespeares]
nicht oder nicht dauerhaft verwirklichen konnte, so steht doch seine Shakespeare
Gallery trotz materiellen Mißerfolgs einzigartig da. Unter den rund
170 Arbeiten befinden sich zahlreiche Werke von Rang, die einen bemerkenswerten
Beitrag zur Interpretation der Dichtung Shakespeares darstellen, ganz
gleich, ob sie die Kriterien der tradierten Geschichtsdarstellung erfüllen,
von ihnen abweichen oder sie gänzlich mißachten. Der den Künstlern
auferlegte Zwang, einen poetischen Stoff in Historienbilder klassizistischen
Zuschnitts umzusetzen, hat dem Projekt eher geschadet als genützt.
Boydells Shakespeare Gallery [...] ist auch wirkungsgeschichtlich von
großer Bedeutung. Sie hat sowohl in England als auch in Deutschland
zahlreiche Nachahmer gefunden. Kein Geringerer als Goethe war einer ihrer
Bewunderer.” |
f. Verlagsflyer (Vorder- / Rückseite)

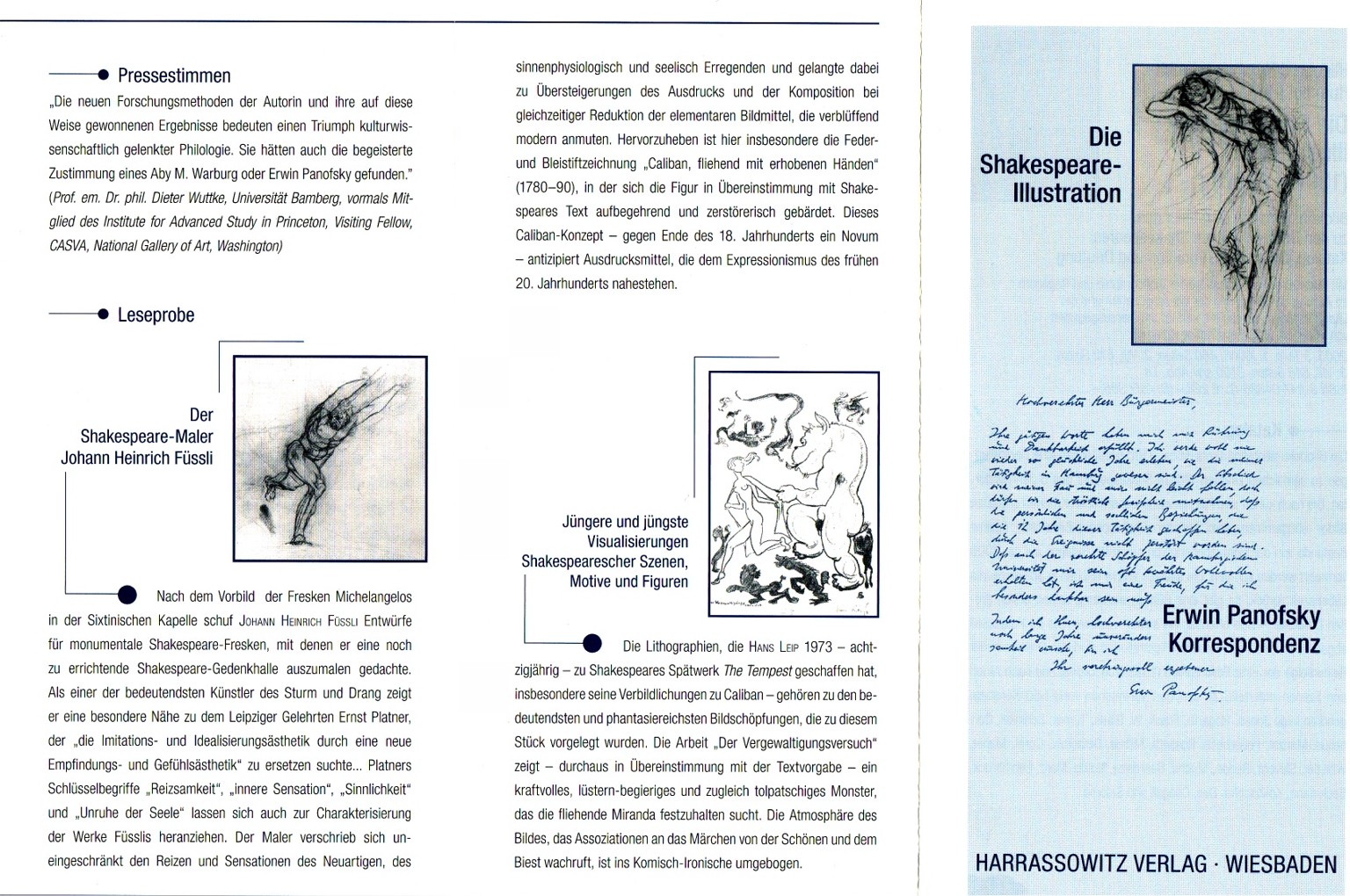
|
Seitenanfang
|



































 





 





 





 |